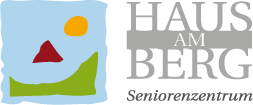Fragen und Antworten rund um die Pflege im Seniorenheim

Hier finden Sie Fragen rund um den Einzug in ein Seniorenheim. Wie nehme ich Oma, Opa die Angst vor einem Seniorenheim. Wie baue ich eigene Schuldgefühle ab? Ich habe zu wenig Geld, Wie finanziere ich das Seniorenheim. Geht das Eigenheim für den Heimplatz drauf? Das Geld reicht nicht, um den Heimplatz zu finanzieren, Was kann ich tun? usw.
Hier finde Sie Antworten auf viele Fragen: Gerne können Sie uns auch bei unseren regelmäßigen „Tag der Pflege“ im Seniorenzentrum besuchen. Hier beantworten wir gerne Ihre Fragen.
🏡 Allgemeine Fragen zur Einrichtung
-
Welche Arten von Seniorenheimen gibt es? (Pflegeheim, betreutes Wohnen, Demenz-WG etc.)
-
Wie finde ich ein passendes Heim? Suche nach Heimen in der Umgebung. Mache einen Termin aus und besuche die Einrichtung.
-
Wie ist die Ausstattung und das Freizeitangebot? Die Heime sind in d. R. alle gleich ausgestattet. Modernere Heime verfügen je nach Nachfrage auch über ein W-Lan für Heimbewohner. Die Freizeitaktivitäten sind der Bewohnerklientel angepasst und können im Heim bei der Sozialen Betreuung erfragt werden.
-
Wie sieht ein typischer Tagesablauf im Heim aus? gegen 8 Uhr, 12 Uhr, 14:30 Uhr, 18:00 Uhr gibt es gemeinsames Essen oder Kaffee und Kuchen der Bewohner. Dazwischen finden Spiele, Artbesuche, Fernseh schauen, oder sonstige Aktivitäten statt.
-
Wie viele Pflegekräfte betreuen wie viele Bewohner? Das ist von den Pflegekassen definiert und hängt von den Pflegegraden der anwesenden Bewohner ab.
-
Gibt es Besuchszeiten oder Einschränkungen? Es gibt eigentlich keine Besuchszeiten. Aber bedenke. Du bist in den Wohnräumen der Menschen die dort leben. Möchtest Du, dass jmd während den Mahlzeiten durch Dein Wohnzimmer läuft? Erkundige Dich nach den Essenszeiten und versuche diese auszusparen. Ein Besuch nach 19:00 Uhr ist auch nicht immer ratsam.
🔹 1. Welche Heime gibt es?
-
Seniorenwohnheim / Betreutes Wohnen:
-
Kein Pflegegrad nötig.
-
Eigenständig wohnen, mit Serviceleistungen.
-
-
Pflegeheim / Altenpflegeheim (stationäre Pflege):
-
Meist ab Pflegegrad 2 sinnvoll.
-
Pflegeleistungen werden von der Pflegekasse bezuschusst.
-
-
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege:
-
Auch hier ist ein Pflegegrad nötig, meist ab Grad 2.
-
Zeitlich begrenzt, z. B. nach Krankenhausaufenthalt.
-
🔹 2. Wie finde ich das passende Heime?
✅ 1. Klärung des Bedarfs
Bevor du suchst, sollte klar sein, welche Art von Einrichtung benötigt wird:
| Bedarf / Lebenssituation | Geeignetes Wohnmodell |
|---|---|
| Selbstständig, aber mit etwas Unterstützung | Betreutes Wohnen |
| Temporäre Pflege (z. B. nach Klinikaufenthalt) | Kurzzeitpflege |
| Dauerhafte Pflegebedürftigkeit | Pflegeheim / stationäre Pflege |
| Demenzerkrankung | Spezialisierte Demenzpflegeeinrichtung |
🔍 2. Wo suchen? – Wichtige Adressen und Portale
🔗 Online-Suchportale:
-
www.pflegelotse.de (AOK) – Umfangreiche Datenbank mit Bewertungen
-
www.heimverzeichnis.de – Qualitätssiegel und Bewertungen
-
www.wohnen-im-alter.de – Suchfunktion nach Ort, Preis, Leistungen
-
Webseiten der Pflegekassen (z. B. TK, Barmer, DAK) bieten oft regionale Suchhilfen
🏢 Vor Ort:
-
Pflegestützpunkte (beraten kostenlos und meist unabhängig)
-
Sozialdienste der Krankenhäuser (oft bei Entlassung hilfreich, bevorzugen aber auch meist Heime zu denen Sie bessere Kontakte haben)
-
Hausarzt oder Sozialarbeiter – manchmal mit Erfahrungswerten, wobei die Hausärzte die Heimarbeit auf Grund der zu geringen Kontakte und Unkenntnis rechtlicher Regelungen meist nicht umfassend beurteilen können.
📝 3. Kriterien für die Auswahl eines Heims
Hier sind einige wichtige Fragen, die du stellen oder prüfen solltest:
📍 Lage & Erreichbarkeit
-
Nah bei Familie, Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten?
-
Gute Anbindung (Bus/Bahn)?
🛏 Pflege & Betreuung
-
Ist das Personal freundlich und gut ausgebildet?
-
Wie hoch ist die Fachkraftquote?
-
Gibt es spezielle Betreuung für Demenz?
🧘♀️ Alltag & Lebensqualität
-
Freizeitangebote, Therapieangebote?
-
Individuelle Gestaltung des Zimmers möglich?
-
Besuchszeiten und Haustierregelungen?
💰 Kosten & Finanzierung
-
Was ist der monatliche Eigenanteil?
-
Wird Pflegegrad berücksichtigt?
-
Zusatzkosten transparent aufgeführt?
📅 4. Heime besichtigen
Unbedingt Besichtigung vereinbaren! Achte dabei auf:
-
Atmosphäre (freundlich? gepflegt?)
-
Gerüche, Sauberkeit wird oft als Hinweis gegeben, kommen Sie jedoch zu einem Besuch und ein Bewohner wurde frich gemacht, kann es schon mal stark riechen. Ebenso Bewohner die sich weigern, sich waschen zu lassen. Leider entsprechen die Standardempfehlungen die zur Heimauswahl gegeben werden, nicht der Praxis.
-
Wie wirken die Bewohner? Werden sie beschäftigt? Auch das geben wir Ihnen als Hinweis, war die Therapiekraft aber am Morgen da und Sie kommen am Mittag, oder wegen Krankheit nicht anwesend, können die Bewohner auch mal unbeschäftigt sein. Oder am Tisch schlafen, weil sie nicht in ihr Zimmer möchten.
-
Sprechen Sie mit dem Pflegepersonal und, wenn möglich, mit den Bewohnern. Leider erkennen Sie meist nicht, wer dement ist etc. SO dass Bewohnerbefragungen auch kritisch zu sehen sind.
📄 5. Wartezeiten & Anmeldung
-
Gute Heime haben oft Wartelisten wir gesagt. Nicht zwingend. Heime die sich die Bewohner raus suchen, können daher schon mal etwas frei haben. Erfragen Sie lieber, ob man alles nimmt oder ob man eine selektive Bewohnerauswahl betreibt, so dass man dadurch das Pflegepersonal und die schon dort lebenden Bewohner vor unangenehmen Zeitgenossen und agressiven Bewohnern und inadäquaten Angehörigen schützt.
-
Eine frühzeitige Anmeldung oder Vormerkung kann sinnvoll sein, jedoch ist die Belegungssituation in Heimem meist dynamisch.
-
Mehrere Heime anfragen, um Optionen zu haben.
🔹 3. Wie sieht der tagesablauf in einem Heim aus?
🕗 Beispielhafter Tagesablauf in einem Pflegeheim
| Uhrzeit | Aktivität |
|---|---|
| 6:30–8:00 Uhr | Aufstehen und Morgenpflege (Waschen, Anziehen, ggf. Hilfe durch Pflegepersonal) |
| 8:00–9:00 Uhr | Frühstück im Speisesaal oder im Zimmer |
| 9:00–11:00 Uhr | Medikamentengabe, Arztvisiten, Aktivierungen (z. B. Gedächtnistraining, Gymnastik, Spaziergänge) |
| 11:30–12:30 Uhr | Mittagessen – in Gemeinschaft oder auf dem Zimmer |
| 12:30–14:00 Uhr | Mittagsruhe / Rückzug ins Zimmer |
| 14:30–15:30 Uhr | Nachmittagskaffee und Kuchen |
| 15:30–17:00 Uhr | Freizeitgestaltung / Beschäftigungsangebote (z. B. Basteln, Musik, Spiele, Singen, Besuchsdienst) |
| 17:30–18:30 Uhr | Abendessen |
| ab 19:00 Uhr | Rückzug aufs Zimmer, Abendpflege, Fernsehen, Lesen, ggf. Hilfe beim Zubettgehen |
| ab 21:00 Uhr | Nachtruhe – mit nächtlicher Kontrolle bei Bedarf |
👥 Ergänzende Angebote (variieren je nach Heim):
-
Physiotherapie / Ergotherapie / Logopädie
-
Friseur, Fußpflege, Gottesdienste im Haus
-
Feste und Veranstaltungen (z. B. Geburtstage, Sommerfest)
-
Angehörigenbesuche (oft täglich möglich)
-
Individuelle Tagesstruktur bei Demenz
🧠 Wichtige Aspekte:
-
Pflegegrade beeinflussen den Tagesablauf: Menschen mit höherem Pflegegrad benötigen mehr Hilfe und Unterstützung (z. B. bei Toilettengängen, Essen, Mobilität).
-
Individuelle Gestaltung ist oft möglich: Manche Bewohner stehen später auf oder möchten lieber im Zimmer essen.
🔹 4. Wie viele Pflegekräfte betreuen wie viele Bewohner?
🔸 Durchschnittlicher Betreuungsschlüssel in Pflegeheimen:
| Pflegekraft (Vollzeit) | Betreut ca. … Bewohner |
|---|---|
| 1 Pflegefachkraft | 10–15 Bewohner |
| 1 Pflegekraft (inkl. Hilfskräfte) | 4–8 Bewohner |
Beispiel: In einem Pflegeheim mit 80 Bewohnern sind tagsüber ca. 10–20 Pflegekräfte (inkl. Hilfskräfte) im Dienst, nachts deutlich weniger.
🔸 Regelungen zur Personalbesetzung:
-
Keine bundesweit einheitlichen Vorgaben, aber seit 2023 wird ein neues Personalbemessungsverfahren eingeführt, das auf den tatsächlichen Pflegebedarf basiert.
-
Die Pflegeversicherung unterscheidet:
-
Pflegefachkräfte (examinierte Pflegekräfte)
-
Pflegehilfskräfte (z. B. Betreuungspersonal, Pflegeassistenten, Hilfskräfte ohne Ausbildung)
-
-
In den meisten Bundesländern gilt ein Mindestanteil von 50 % Fachkräften im Pflegeteam.
🔸 Personalschlüssel nach Tageszeit (typisch):
| Tageszeit | Pflegekräfte pro Bewohner |
|---|---|
| Tagsüber | ca. 1 Pflegekraft pro 6–8 Bewohner |
| Abends | ca. 1 Pflegekraft pro 10–15 Bewohner |
| Nachts | oft nur 1 Pflegekraft für 30–50 Bewohner |
In der Nacht sind meist nur Notfallversorgung und Grundpflege vorgesehen. Eine Fachkraft muss jedoch immer erreichbar sein.
💰 Finanzielle und rechtliche Fragen
-
Was kostet ein Platz im Seniorenheim?
-
Wer übernimmt die Kosten – Pflegekasse, Sozialamt, Angehörige?
-
Welche Leistungen zahlt die Pflegeversicherung?
-
Was passiert, wenn das eigene Vermögen nicht ausreicht?
-
Müssen Kinder für die Heimkosten aufkommen? (Stichwort: Elternunterhalt)
-
Welche Verträge müssen unterschrieben werden
🔹 1. Was kostet ein Platz im Seniorenheim?
💰 Gesamtkosten pro Monat (bundesweiter Durchschnitt 2025):
| Pflegegrad | Gesamtkosten | Leistung der Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | ca. 2.500–3.500 € | 125 € (Entlastungsbetrag) | Fast alles selbst zu zahlen |
| Pflegegrad 2 | ca. 3.000–4.000 € | 770 € | ca. 2.200–3.200 € |
| Pflegegrad 3 | ca. 3.200–4.200 € | 1.262 € | ca. 2.000–3.000 € |
| Pflegegrad 4 | ca. 3.500–4.500 € | 1.775 € | ca. 1.900–2.800 € |
| Pflegegrad 5 | ca. 3.700–4.800 € | 2.005 € | ca. 1.800–2.800 € |
🔸 Die Eigenanteile unterscheiden sich regional stark – in Bayern, Baden-Württemberg oder NRW z. B. deutlich höher als in Sachsen oder Thüringen.
📦 Was ist in den Kosten enthalten?
Die Gesamtkosten setzen sich aus mehreren Bausteinen zusammen:
| Kostenart | Was ist das? |
|---|---|
| Pflegekosten | Pflegeleistungen, Betreuung (abhängig vom Pflegegrad) |
| Unterkunft & Verpflegung | Zimmer, Essen, Reinigung, Nebenkosten |
| Investitionskosten | Instandhaltung des Gebäudes etc. |
| Ausbildungsumlage | Beteiligung an der Ausbildungskosten für Pflegekräfte |
| Zusatzleistungen (optional) | z. B. Einzelzimmer, besondere Betreuung, Friseur etc. |
💡 Wichtig zu wissen:
-
Eigenanteil ist nicht abhängig vom Pflegegrad – seit 2022 zahlen alle Pflegebedürftigen den gleichen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) für Pflegeleistungen. Nur der Zuschuss der Pflegekasse steigt mit höherem Pflegegrad.
-
Die Pflegekasse übernimmt nur einen Teil der Pflegekosten, nicht Unterkunft oder Verpflegung.
🆘 Was tun, wenn das Geld nicht reicht?
Wenn Einkommen und Vermögen nicht ausreichen:
-
Antrag auf „Hilfe zur Pflege“ beim Sozialamt stellen. z. B. Saarpfalzkreis, Pirmasenser Stadt, Land etc.
-
Es erfolgt ggf. eine Unterhaltsprüfung bei Angehörigen (Kinder mit Einkommen über 100.000 € brutto/Jahr).
-
Vermögen bis zu ca. 10.000 € darf meist behalten werden.
🔹 Leistungen der Pflegeversicherung (2025, monatlich)
💡 Pflegegrade 1 bis 5 – Übersicht der wichtigsten Leistungen:
| Pflegegrad | Pflegesachleistungen (ambulant) | Pflegegeld (für Angehörige) | Stationäre Pflege (Heim) |
|---|---|---|---|
| PG 1 | – | – | 125 € (Entlastungsbetrag) |
| PG 2 | 761 € | 332 € | 770 € |
| PG 3 | 1.432 € | 573 € | 1.262 € |
| PG 4 | 1.778 € | 765 € | 1.775 € |
| PG 5 | 2.200 € | 947 € | 2.005 € |
📌 Pflegesachleistungen: Pflegedienst kommt nach Hause.
📌 Pflegegeld: Auszahlung an Pflegebedürftige, die zu Hause z. B. von Angehörigen gepflegt werden.
📌 Stationäre Pflege: Zuschuss zu Heimkosten – der Eigenanteil bleibt erheblich.
🔸 Zusätzliche Leistungen je nach Bedarf:
| Leistung | Monatlicher Betrag (2025) | Hinweise |
|---|---|---|
| Entlastungsbetrag | 125 € (ab PG 1) | Für Haushaltshilfen, Betreuung etc. – zweckgebunden |
| Verhinderungspflege | bis 1.612 € / Jahr | Wenn pflegende Angehörige verhindert sind |
| Kurzzeitpflege | bis 1.774 € / Jahr | Zeitweise stationäre Pflege (z. B. nach Klinik) |
| Tages- und Nachtpflege | Zusätzlich zu Pflegegeld möglich | Entlastung für Angehörige |
| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | bis 40 € / Monat | Z. B. Handschuhe, Desinfektionsmittel |
| Wohnraumanpassung | bis 4.000 € (einmalig) | Für Umbauten: z. B. barrierefreies Bad, Treppenlift |
| Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) | bis 50 € / Monat | Z. B. Apps für Sturzprävention, Gedächtnistraining |
| Pflegekurse für Angehörige | Kostenlos | In Präsenz oder online |
🏥 Besonderheit bei stationärer Pflege:
Seit 2022 gibt es Zusatz-Zuschüsse, je länger man im Heim lebt:
| Dauer im Heim | Zuschuss zum Eigenanteil an Pflegekosten |
|---|---|
| 1. Jahr | 15 % |
| 2. Jahr | 30 % |
| 3. Jahr | 50 % |
| Ab 4. Jahr | 75 % |
Gilt nur für pflegebedingte Kosten, nicht für Unterkunft/Verpflegung!
🔹 4. Welche Verträge müssen unterschrieben werden?
1. 📝 Pflegevertrag
-
Inhalt: Regelt die pflegerische Versorgung durch das Heim.
-
Wichtigste Punkte:
-
Pflegeleistungen (nach Pflegegrad)
-
Personalstruktur
-
Haftungsregelungen
-
Kündigungsfristen
-
-
Gesetzliche Grundlage: § 75 SGB XI
2. 🏠 Wohn- oder Heimvertrag
-
Inhalt: Regelt Unterkunft, Verpflegung und allgemeine Betreuung.
-
Wichtigste Punkte:
-
Zimmerart (Einzel- oder Doppelzimmer)
-
Hausordnung
-
Reinigungsdienste, Mahlzeiten
-
Mitnahme eigener Möbel
-
🧑⚕️ Pflege und medizinische Versorgung
-
Welche Pflegestufe oder Pflegegrad wird benötigt? Pflegegrad 2 wird i. d. R. benötigt.
-
Wie wird der Pflegebedarf ermittelt? dazu haben die Heime i. d. R. ein Begutachtungsinstrument, welches 1:1 dem des MD ähnelt. Hier kann der Pflegegrad ermittelt werden.
-
Wie funktioniert die medizinische Versorgung im Heim? Die Fachkräfte stimmen sich mit dem Hausarzt ab, der die Federführung der Verordnungen übernimmt. Die Ausführung erfolgt durch die Fachkräfte des Heimes
-
Gibt es spezialisierte Angebote z. B. für Demenzkranke?
-
Was passiert bei einem Notfall?
🔹 1. Pflegegrad und Pflegeheim – was ist der Zusammenhang?
-
Pflegegrad 1 bis 5: Diese werden durch den Medizinischen Dienst (MD) nach Begutachtung vergeben und spiegeln den Grad der Selbstständigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit wider.
-
Pflegegrad notwendig?
-
Für ein reines Pflegeheim (vollstationäre Pflege) ist mindestens Pflegegrad 2 erforderlich, wenn die Pflegekasse sich an den Kosten beteiligen soll.
-
Ohne Pflegegrad muss man die Kosten selbst tragen – das kann sehr teuer sein.
-
Ein Pflegegrad 1 reicht für den Anspruch auf gewisse Entlastungsleistungen, aber nicht für die stationäre Pflegefinanzierung.
-
🔹 2. Wie bekommt man einen Pflegegrad?
-
Antrag bei der Pflegekasse (Teil der Krankenkasse) stellen.
-
Besuch durch den Medizinischen Dienst (MD).
-
Einstufung in einen Pflegegrad (1–5).
-
Danach: Möglichkeit der (teilweisen) Finanzierung durch die Pflegekasse.
🔹 3. Wie funktioniert die medizinische Versorgung im Heim?
🩺 1. Hausärztliche Versorgung
-
Bewohner behalten ihren bisherigen Hausarzt, wenn dieser Hausbesuche macht.
-
Alternativ: Kooperationsärzte, die regelmäßig ins Heim kommen.
-
Arztbesuche finden meist im Zimmer oder in einem Sprechzimmer im Heim statt.
💡 Bewohner dürfen den Arzt grundsätzlich frei wählen – es sei denn, ein Kooperationsvertrag mit festen Ärzten besteht und kein anderer verfügbar ist.
💊 2. Medikamente und Rezepte
-
Der Arzt verschreibt wie gewohnt Rezepte.
-
Die Pflegekräfte kümmern sich um die Bestellung, Abholung und Verabreichung der Medikamente.
-
Oft gibt es Kooperationsapotheken, die das Heim direkt beliefern.
🏥 3. Fachärztliche Versorgung
-
Fachärzte (z. B. Neurologen, Augenärzte) besuchen Heime oft regelmäßig oder nach Bedarf.
-
Alternativ müssen Transport und Begleitung organisiert werden, wenn ein Praxisbesuch nötig ist.
-
Manche Heime bieten regelmäßige Visiten mit bestimmten Fachärzten an (z. B. Zahnarzt, Geriater, Psychiater bei Demenz).
👂 4. Therapien & Hilfsmittel
-
Verordnungen für:
-
Physiotherapie
-
Ergotherapie
-
Logopädie
-
-
Durchführung meist durch externe Therapeuten, die ins Heim kommen.
-
Hilfsmittelversorgung (Rollator, Pflegebett, Inkontinenzartikel) über Sanitätshaus und Arztverordnung.
🧑⚕️ 5. Pflegekräfte und medizinische Aufgaben
-
Pflegekräfte übernehmen:
-
Medikamentengabe
-
Blutzuckermessung, Blutdruck
-
Wundversorgung
-
Kommunikation mit Ärzten und Angehörigen
-
⚠️ Sie dürfen keine ärztlichen Entscheidungen treffen, aber sie erkennen Veränderungen und informieren den Arzt.
📋 6. Notfallversorgung
-
Pflegeheime haben interne Notfallpläne.
-
Bei akuten Problemen wird der Notarzt gerufen oder der Bewohner ins Krankenhaus gebracht.
-
Manche Heime sind an einen ärztlichen Bereitschaftsdienst angeschlossen.
❤️ Emotionale und zwischenmenschliche Aspekte
-
Wie gewöhnen sich Angehörige an das Heim?
-
Wie kann ich meine Mutter/meinen Vater emotional unterstützen?
-
Was ist, wenn der Angehörige nicht ins Heim will?
-
Wie kann man Schuldgefühle oder Scham bewältigen?
-
Wie häufig sollte man zu Besuch kommen?
📦 Organisation und Umzug
-
Wie läuft der Umzug ins Heim ab?
-
Was darf oder muss man mitbringen (z. B. Möbel, Kleidung, Medikamente)?
-
Was passiert mit der bisherigen Wohnung?
-
Wie kann ich den Übergang möglichst sanft gestalten?
🧓 Wie sich der Heimbewohner selbst gewöhnt:
1. Anfangszeit realistisch einschätzen
-
Die ersten Tage oder Wochen können schwierig sein: Unsicherheit, Heimweh oder sogar Ablehnung sind normal.
-
Manche Menschen brauchen länger als andere, um sich einzuleben – das ist individuell.
2. Vertrautes mitnehmen
-
Persönliche Gegenstände wie Fotos, Lieblingsmöbel oder Decken helfen, ein Gefühl von Zuhause zu bewahren.
-
Auch gewohnte Rituale, etwa das gemeinsame Kaffeetrinken oder Lieblingsmusik, können emotional stabilisieren.
3. Beziehungsaufbau zu Mitbewohnern und Personal
-
Ermutige zu Kontakt und Teilnahme an Gruppenangeboten – soziale Einbindung wirkt stark gegen Isolation.
-
Positiver Umgang mit dem Pflegepersonal fördert Vertrauen und das Gefühl von Sicherheit.
👨👩👧 Wie sich die Angehörigen daran gewöhnen:
1. Gefühle ernst nehmen – aber einordnen
-
Viele Angehörige empfinden Schuldgefühle, Zweifel oder sogar Trauer.
-
Wichtig: Der Umzug ins Heim ist keine Aufgabe, sondern eine Form von Fürsorge, wenn die häusliche Pflege nicht mehr möglich ist.
2. Regelmäßige, aber nicht überfürsorgliche Besuche
-
Häufige Besuche zu Beginn helfen dem neuen Bewohner bei der Eingewöhnung.
-
Gleichzeitig sollten Angehörige auch loslassen lernen und Freiraum geben – das fördert Selbstständigkeit und Integration.
3. Austausch mit dem Pflegepersonal
-
Sprich offen mit dem Team über Sorgen, Wünsche oder Beobachtungen.
-
Viele Heime bieten Angehörigengespräche oder -nachmittage an – das hilft beim Vertrauen.
4. Geduld und Zeit
-
Die emotionale Umstellung kann Wochen oder sogar Monate dauern.
-
Rückschritte (z. B. wenn der Angehörige „wieder nach Hause will“) sind normal – dranbleiben und unterstützend begleiten.
🔄 Tipp: Den Übergang aktiv gestalten
-
Den Umzug gut vorbereiten (nicht überraschend oder überstürzt).
-
Möglichst den Angehörigen in Entscheidungen einbeziehen.
-
Übergangsrituale schaffen (z. B. jeden Sonntag gemeinsam Kaffee trinken oder telefonieren).
Wie kann ich meine Mutter/meinen Vater emotional unterstützen?
❤️ 1. Verständnis zeigen – nicht bewerten
-
Ernst nehmen, was sie fühlen: Ängste, Unsicherheit, Wut oder Traurigkeit sind völlig normale Reaktionen.
-
Keine Sätze wie: „Jetzt reiß dich zusammen“ oder „Du hast es doch gut hier“ – sie können abwertend wirken.
-
Stattdessen: Zuhören, nicken, beruhigen. Zum Beispiel:
„Ich verstehe, dass das alles viel für dich ist. Ich bin bei dir.“
🧓 2. Selbstbestimmung stärken
-
Beziehe sie in Entscheidungen mit ein – etwa bei der Zimmergestaltung oder beim Tagesablauf.
-
Auch kleine Dinge wie die Wahl der Kleidung, Essensvorlieben oder das Mitbringen persönlicher Gegenstände geben das Gefühl von Kontrolle zurück.
🧳 3. Vertrautheit schaffen
-
Richte das Zimmer wohnlich ein: Fotos, Lieblingsmöbel, Bücher, Pflanzen, ein vertrauter Duft (z. B. Parfüm, Tee).
-
Rituale pflegen: z. B. jeden Mittwoch telefonieren oder jeden Sonntag gemeinsam essen gehen.
🤝 4. Regelmäßiger Kontakt
-
Besuche regelmäßig, vor allem in der Anfangszeit. Schon ein kurzer Besuch wirkt oft beruhigend.
-
Wenn Besuche nicht möglich sind: Telefonate, Videocalls, Briefe oder Sprachnachrichten machen viel aus.
-
Wichtig: Verlässlichkeit – wenn du etwas versprichst (z. B. „Ich komme Dienstag“), dann halte es ein.
🎯 5. Perspektive geben
-
Versuche, gemeinsam positive Aspekte zu sehen: Sicherheit, soziale Kontakte, Aktivitäten, Entlastung von Alltagslast.
-
Ermutige zur Teilnahme an Gruppenangeboten, ohne zu drängen.
🧘♀️ 6. Deine eigene Gelassenheit wirkt
-
Wenn du selbst gestresst, ungeduldig oder traurig bist, überträgt sich das.
-
Achte auf dich, sprich mit anderen Angehörigen oder Freunden über deine Gefühle.
-
Du musst nicht perfekt stark sein – aber ehrlich und liebevoll.
🔄 7. Die Bindung bleibt – auch im Heim
-
Erinnere sie daran: Sie bleiben deine Mutter oder dein Vater, egal wo sie wohnen.
-
Fotos aus der Familiengeschichte anschauen, über frühere Zeiten sprechen – das stärkt Zugehörigkeit.
🧠 Warum lehnen viele den Umzug ab?
-
Angst vor Kontrollverlust (Fremdbestimmung, Regeln)
-
Sorge vor Einsamkeit oder Isolation
-
Negative Bilder von Pflegeheimen aus der Vergangenheit
-
Scham, nicht mehr „selbstständig“ zu sein
-
Trauer um das Zuhause und die vertraute Umgebung
-
Verdrängung: Sie erkennen (noch) nicht, wie dringend Hilfe nötig ist
🧭 Was kannst du tun?
1. Geduldig zuhören, nicht sofort überzeugen
-
Nimm die Sorgen ernst, ohne sie gleich zu entkräften.
-
Frage nach den genauen Ängsten: „Was genau macht dir daran am meisten Angst?“
-
Zeige Verständnis: „Ich weiß, dass das eine große Veränderung ist. Es fällt auch mir nicht leicht.“
2. Realistische Perspektiven aufzeigen
-
Erkläre konkret, warum die häusliche Pflege nicht mehr ausreicht.
-
Vermeide Drohungen oder Schuldgefühle („Wenn du nicht gehst, passiert etwas Schlimmes“), sondern biete Klarheit:
„Ich mache mir große Sorgen, dass du stürzt, wenn du alleine bist. Im Heim bist du sicherer.“
3. Kompromissvorschläge machen
-
Probeaufenthalt anbieten – viele Heime ermöglichen 2–4 Wochen zur „Schnupperphase“.
-
Betreutes Wohnen oder Tagespflege als Zwischenschritt prüfen.
-
Das nimmt oft den Druck und gibt beiden Seiten mehr Sicherheit.
4. Frühzeitig einbinden
-
Lasse deinen Angehörigen (wenn möglich) mitentscheiden: Heim auswählen, Zimmer einrichten, Angebote kennenlernen.
-
Manchmal hilft auch ein Besuch im Heim, bevor überhaupt etwas entschieden wird.
5. Professionelle Hilfe einbeziehen
-
Hausarzt, Pflegeberater oder Sozialdienst können das Gespräch unterstützen.
-
Eine neutrale, fachliche Meinung wirkt oft überzeugender als die der Familie.
⚖️ Was, wenn die Ablehnung bleibt?
Wenn die Person noch einwilligungsfähig ist:
-
Sie kann grundsätzlich selbst entscheiden – auch wenn das aus deiner Sicht nicht klug ist.
-
Nur bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung kann über eine Betreuung (rechtlich) entschieden werden.
Wenn die Person nicht mehr einwilligungsfähig ist:
-
Dann kann ein rechtlicher Betreuer (falls vorhanden) oder ein Vorsorgebevollmächtigter entscheiden.
-
Wichtig ist dabei immer: Der mutmaßliche Wille und das Wohl der Person müssen im Mittelpunkt stehen.
🧩 Fazit
👉 Nicht drängen – sondern begleiten.
👉 Nicht gegen den Willen – sondern auf Augenhöhe.
👉 Nicht sofort handeln – sondern gemeinsam Schritte gehen.
🧭 Warum entstehen Schuldgefühle?
-
Überhöhte Erwartungen an sich selbst („Ich müsste das allein schaffen.“)
-
Gesellschaftlicher oder familiärer Druck
-
Unverarbeitete familiäre Themen (z. B. alte Schuld, ungelöste Konflikte)
-
Verinnerlichte Werte wie: „Die Familie sorgt bis zum Schluss selbst.“
-
Abschied vom Idealbild, was man seinen Eltern „schuldet“
🧠 Wie kann man Schuldgefühle und Scham bewältigen?
1. ✅ Akzeptieren, dass man an Grenzen kommt
Pflege zu Hause ist emotional und körperlich extrem belastend. Es ist keine Schwäche, sondern Verantwortung, rechtzeitig Unterstützung zu holen – besonders, wenn es um Sicherheit, Würde und Lebensqualität geht.
💬 „Ich habe mein Bestes getan – aber niemand kann alles alleine schaffen.“
2. 🤝 Sich bewusst machen: Ein Heim kann Fürsorge sein
Ein gutes Seniorenheim bedeutet nicht „Abschieben“, sondern:
-
Rund-um-die-Uhr-Versorgung
-
Soziale Kontakte
-
Strukturierter Alltag
-
Entlastung für Angehörige = bessere Besuche, weniger Überforderung
💬 „Ich ermögliche meinen Eltern professionelle Hilfe – das ist eine Form von Liebe.“
3. 📚 Informieren und reflektieren
Je besser du die Gründe, Abläufe und Möglichkeiten kennst, desto sicherer fühlst du dich in deiner Entscheidung. Wissen schützt vor irrationaler Schuld.
4. ❤️ In Kontakt bleiben und Bindung pflegen
-
Regelmäßige Besuche oder Anrufe zeigen: „Ich bin für dich da.“
-
Die Rolle verändert sich – aber die Liebe bleibt.
-
Viele Heimbewohner sagen rückblickend: „Es war gut so.“
5. 🧘♀️ Eigene Gefühle bewusst zulassen – und loslassen
-
Schreibe deine Gedanken auf (Tagebuch, Brief an dich selbst).
-
Sprich mit Freunden, einem Therapeuten oder in Angehörigengruppen.
-
Verwechsle Schuld nicht mit Verantwortung: Du bist nicht schuldig – du übernimmst Verantwortung.
📌 Konkrete Übungen gegen Schuldgefühle
📝 1. Brief an dich selbst
„Was habe ich alles versucht?“
„Was wünsche ich mir für meine Mutter/meinen Vater?“
„Was würde mein Vater sagen, wenn er wüsste, wie ich mich fühle?“
💭 2. Perspektivwechsel:
Stell dir vor, dein eigenes Kind steht irgendwann vor dieser Entscheidung – würdest du ihm Vorwürfe machen oder Verständnis zeigen?
✨ Fazit:
Schuldgefühle zeigen, wie wichtig dir dein Angehöriger ist.
Aber du darfst lernen, sie als ein Signal – nicht als Urteil – zu verstehen.
_______________
Zur Optimierung unserer Qualität im Heim nutzen wir Standards. Und zwar die Expertenstandards.
Expertenstandards in der Altenpflege sind bundesweit anerkannte, wissenschaftlich fundierte Richtlinien, die von der „Expertengruppe des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)“ erarbeitet werden. Sie dienen der Sicherstellung und Verbesserung der Pflegequalität in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen.
✅ Ziele und Funktionen der Expertenstandards
-
Qualitätssicherung und -entwicklung
Sie legen einheitliche Anforderungen an die Pflege fest und dienen als Grundlage für eine professionelle, qualitätsorientierte Pflegepraxis. -
Wissenschaftlich fundierte Pflegepraxis
Die Standards basieren auf aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und fördern evidenzbasiertes Arbeiten. -
Rechtliche Orientierung
Bei Schadensfällen können Expertenstandards als Maßstab für „fachgerechtes Handeln“ herangezogen werden (z. B. vor Gericht). -
Transparenz und Vergleichbarkeit
Einrichtungen können ihre Pflegeleistungen vergleichbar und überprüfbar gestalten. -
Schulung und Weiterbildung
Die Standards dienen als Grundlage für Fortbildungen und Schulungen in der Pflege.
📋 Aktuelle Expertenstandards (Stand 2025, Auswahl)
-
Erhaltung und Förderung der Mobilität
-
Dekubitusprophylaxe in der Pflege
-
Sturzprophylaxe in der Pflege
-
Schmerzmanagement (akute und chronische Schmerzen)
-
Förderung der Harnkontinenz
-
Pflege von Menschen mit Demenz
-
Ernährungsmanagement zur Sicherstellung der Nahrungsaufnahme
-
Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz
-
Erhaltung und Förderung der Mundgesundheit
-
Entlassungsmanagement in der Pflege
-
Förderung der physiologischen Schlafqualität
_____________
✅ Neutrale & praxisfundierte Checkliste für die Heim-Besichtigung
Fokus: Realistische Einschätzung ohne Fehlinterpretationen
🏠 1. Erster Eindruck des Hauses – mit Vorsicht zu bewerten
| Beobachtung | Bewertungshinweis |
| Freundlicher Empfang | Kein Muss, aber oft Indiz für wertschätzende Kultur |
| Allgemeine Sauberkeit | Achte auf systematische Reinigung – nicht auf akute Missgeschicke |
| Geruch im Haus | Einzelgerüche sind normal – bewerte nur dauerhaften, beißenden Geruch in mehreren Bereichen |
| Lärmpegel | Auch Lachen, Husten oder Rufen kann normal sein – achte eher auf gestresste Stimmung oder dauerhaftes Chaos |
🧠 Tipp: Sprich Mitarbeitende direkt an, wenn dir etwas „komisch“ vorkommt – oft gibt es eine einfache Erklärung.
👥 2. Umgang mit Bewohnern – Verhalten statt Situationen
| Beobachtung/Frage | Worauf achten? |
| Werden Bewohner mit Namen angesprochen? | Zeigt Wertschätzung und Biografiebezug |
| Reagieren Pflegekräfte ruhig auf Unruhe, Missgeschicke, lautes Verhalten? | Geduldiger Umgang ist ein gutes Zeichen |
| Sind Bewohner alleine im Flur? | Kommt vor – frag lieber nach: „Ist hier jemand zuständig?“ |
| Wie werden herausfordernde Verhaltensweisen gehandhabt? | Erkundige dich, statt zu urteilen |
🕰 3. Tagesstruktur & Aktivitäten – nicht an Momentaufnahmen messen
| Frage / Beobachtung | Warum wichtig? |
| Gibt es einen Wochenplan oder Aushang mit Aktivitäten? | Struktur erkennbar |
| Frag: „Wie ist der Ablauf für einen typischen Tag?“ | Gibt realistische Einblicke |
| Ist gerade Mittagsruhe oder Essenszeit? | Kein Zeichen für „Langeweile“ |
| Gibt es Rückzugsräume UND Gemeinschaftsbereiche? | Bedarfsgerechte Gestaltung |
🧠 Nicht vorschnell denken: „Hier passiert ja nichts.“ → Es kann gerade Essenszeit oder Therapierunde sein.
🛏 4. Zimmer & Bad – gesetzliche Mindeststandards gelten überall
| Punkt | Neutral bewerten bedeutet… |
| Zimmergröße / Bad | Nur bei echten Mängeln (z. B. kein Notruf, keine Bewegungsfreiheit) kritisch |
| Persönliche Gestaltung | Manche Bewohner mögen es schlicht |
| Geruch im Zimmer | Bewohnerindividuell – nicht pauschal bewerten |
| Pflegehilfsmittel sichtbar | Zeigt oft gute Ausstattung, nicht „Unordnung“ |
📋 5. Pflege & Organisation – gezielte Fragen statt Mutmaßungen
| Frage | Worauf hören? |
| „Wie wird Bezugspflege hier umgesetzt?“ | Gibt es feste Ansprechpartner? |
| „Wie reagieren Sie auf akute Zwischenfälle?“ | Ehrlichkeit & Ruhe zählen mehr als „perfekter Eindruck“ |
| „Wie lange ist das Team in dieser Konstellation aktiv?“ | Teamstabilität ist aussagekräftiger als Einzelpersonen |
| „Was passiert, wenn es Konflikte mit Angehörigen oder Bewohnern gibt?“ | Guter Umgang mit Beschwerden ist wichtiger als deren Vermeidung |
👨👩👧 6. Einbindung von Angehörigen & Transparenz
| Frage / Punkt | Relevanz |
| „Wie oft finden Gespräche mit Angehörigen statt?“ | Kommunikation = Qualität |
| „Gibt es eine Möglichkeit zur Mitwirkung (z. B. Heimbeirat)?“ | Verpflichtend, aber: Wie aktiv ist er? |
| „Wie transparent sind Abrechnungen und Zusatzleistungen?“ | Ehrlichkeit zählt mehr als Schönreden |
❤️ 7. Atmosphäre & Haltung – achte auf Stimmung, nicht Einzelvorfälle
| Beobachtung | Interpretation |
| Lächeln Pflegekräfte? | Grundstimmung sichtbar |
| Sind Gespräche mit Bewohnern wertschätzend – auch bei Demenz? | Haltung zählt |
| Wie reagieren Mitarbeitende auf spontane Fragen? | Offenheit ist ein gutes Zeichen |
🚫 Was du nicht überbewerten solltest:
| Situation | Warum relativ? |
| Bewohner mit Essensresten an Kleidung | Kann passieren, gehört zur Normalität |
| Ein stark riechendes Zimmer | Nicht automatisch Hygienemangel |
| Einzelner Bewohner wirkt ungepflegt | Erst fragen: Ist das sein Wunschzustand? |
| Nackter Bewohner im Speisesaal | Kann bei Demenz vorkommen – Frage: Wie geht das Team damit um? |
📌 Zusammenfassung:
🔑 Beurteile ein Heim nie anhand einzelner Momente, sondern:
- Achte auf Systematik, Reaktion, Haltung und Kommunikation
- Stell offene, ehrliche Fragen – vermeide schnelle Urteile
- Nutze objektive Kriterien wie: Stabilität, Struktur, Umgang mit Krisen
________
Über den Autor.
Dirk Mahren studierte Betrieswirtschaftslehre und hatte viele Jahre einer der ersten ambulanten Pflegedienste im Saarland. Er ist seit Jahren Berater für Kliniken und Pflegeheime u. a. bei der optimierung derProzesse. 20 Jahre war er Hoschuldozent im Stundiengang Gesundheits- und Sozialmanegement sowie im Studiengang Pflegemenagamenet. Seit 2013 ist er Einrichtungsleiter eine Pflegeeinrichtung und Leiter der eigenständigen Catering Firma.